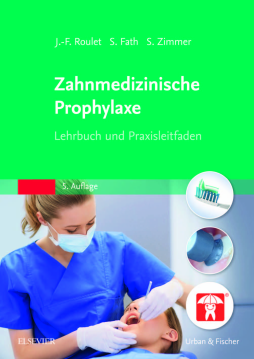
Additional Information
Book Details
Abstract
Zum Lernen und Nachschlagen
Einfühlsame Patientenführung, zahnmedizinische Hintergründe, strukturierte Arbeitsabläufe sowie praktische Hilfsmittel werden anschaulich und ausführlich dargestellt.
Ausbildung auf höchstem Niveau: Alle notwendigen fachlichen Inhalte zur Ausbildung der Zahnmedizinsichen Prophylaxeassistentin und Dentalhygienikerin werden leicht und einprägsam vorgestellt.
Dieses Lehrbuch der Musterfortbildungsordnung der Bundeszahnärztekammer für die Ausbildungsinhalte der Zahnmedizinischen Prophylaxeassistentin.
Der Inhalt wurde ergänzt und für zusätzliche Berufsfelder (Studierende der Zahnmedizin, Dentalhygienikerinnen und Zahnmediziner) erweitert.
Table of Contents
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Front Cover | Cover | ||
| Zahnmedizinische Prophylaxe | I | ||
| Zahnmedizinsche Prophylaxe | III | ||
| Copyright | IV | ||
| Vorwort zur 5. Auflage | V | ||
| Autorenverzeichnis | VI | ||
| Abbildungsnachweis | VII | ||
| Inhaltsverzeichnis | IX | ||
| 1 - Anatomie und Histologie der Mundhöhle | 1 | ||
| 1.1 Allgemeines | 1 | ||
| 1.2 Gesicht | 2 | ||
| 1.3 Mundhöhle (Cavum oris) | 3 | ||
| 1.3.1 Mundvorhof (Vestibulum) | 3 | ||
| 1.3.2 Gaumen (Palatum) | 3 | ||
| 1.3.3 Wangen (Buccae) | 4 | ||
| 1.3.4 Zunge (Lingua, Glossa) | 4 | ||
| 1.3.5 Mundboden | 4 | ||
| 1.4 Mundschleimhaut | 6 | ||
| 1.5 Gesichtsskelett | 6 | ||
| 1.5.1 Hirnschädel | 6 | ||
| 1.5.2 Oberkiefer (Maxilla) | 7 | ||
| 1.5.3 Unterkiefer (Mandibula) | 7 | ||
| 1.6 Kiefergelenk | 10 | ||
| 1.7 Muskulatur | 11 | ||
| 1.7.1 Gesichtsmuskulatur | 11 | ||
| 1.7.2 Kaumuskulatur | 11 | ||
| 1.8 Innervation | 14 | ||
| 1.8.1 Nervus facialis | 14 | ||
| 1.8.2 Nervus trigeminus | 14 | ||
| 1.9 Blutgefäße | 16 | ||
| 1.9.1 Arterien | 16 | ||
| 1.9.2 Venen | 17 | ||
| 1.10 Lymphabfluss | 18 | ||
| 1.11 Speicheldrüsen | 19 | ||
| 2 - Zähne | 21 | ||
| 2.1 Zahnzahl und\rZahnbezeichnungen | 21 | ||
| 2.1.1 Bleibendes Gebiss | 21 | ||
| 2.1.2 Milchgebiss und Zahnwechsel | 22 | ||
| 2.2 Allgemeine Anatomie der Zähne | 22 | ||
| 2.2.1 Aufbau der Zähne | 22 | ||
| 2.2.2 Orts- und Richtungsbezeichnungen | 24 | ||
| 2.3 Spezielle Anatomie der Zähne | 25 | ||
| 2.3.1 Bleibendes Gebiss | 25 | ||
| 2.3.2 Milchgebiss | 26 | ||
| 2.3.3 Spezielle Anatomie der Fissuren | 26 | ||
| 2.4 Zahnentwicklung | 27 | ||
| 2.5 Zahnschmelz: Entstehung und Struktur | 28 | ||
| 2.6 Dentin: Entstehung und Struktur | 31 | ||
| 2.7 Pulpa: Entstehung und Struktur | 32 | ||
| 2.8 Zement: Entstehung und Struktur | 33 | ||
| 2.9 Entwicklungsstörungen | 33 | ||
| 2.10 Parodont | 35 | ||
| 2.10.1 Gingiva | 35 | ||
| 2.10.2 Desmodont | 36 | ||
| 3 - Speichel | 39 | ||
| 3.1 Zusammensetzung | 40 | ||
| 3.2 Spülwirkung | 40 | ||
| 3.3 Antimikrobielle Wirkung | 41 | ||
| 3.4 Pufferwirkung | 42 | ||
| 3.5 Remineralisierung | 42 | ||
| 3.6 Eingeschränkter Speichelfluss | 42 | ||
| 4 - Zahnbeläge | 45 | ||
| 4.1 Schmelzoberhäutchen (Pellikel) | 45 | ||
| 4.1.1 Definition | 45 | ||
| 4.1.2 Entstehung | 45 | ||
| 4.1.3 Funktion | 47 | ||
| 4.2 Eingelagerte körperfremde Farbstoffe | 48 | ||
| 4.3 Plaque | 49 | ||
| 4.3.1 Definition | 49 | ||
| 4.3.2 Biofilm | 49 | ||
| 4.3.3 Mikroorganismen in der Mundhöhle | 51 | ||
| 4.3.4 Stoffwechsel der Mikroorganismen | 52 | ||
| 4.3.5 Entstehung und Struktur der Plaque | 57 | ||
| 4.4 Zahnstein | 61 | ||
| 5 - Erkrankungen der Zähne und des Zahnhalteapparates | 63 | ||
| 5.1 Karies | 63 | ||
| 5.1.1 Entstehung der Karies | 64 | ||
| 5.1.2 Behandlung der Karies | 68 | ||
| 5.1.3 Kariesprophylaxe | 68 | ||
| 5.2 Erkrankungen der Pulpa | 75 | ||
| 5.2.1 Akute Entzündung der Pulpa | 76 | ||
| 5.2.2 Chronische Entzündung der Pulpa | 76 | ||
| 5.3 Entzündungen der Gingiva und des Parodontiums | 78 | ||
| 5.3.1 Ursachen der Gingivitis und Parodontitis | 78 | ||
| 5.3.2 Entwicklung der Gingivitis, Übergang zur Parodontitis | 81 | ||
| 5.3.3 Parodontale Läsion | 85 | ||
| 5.3.4 Kofaktoren | 86 | ||
| 5.3.5 Klassifikation parodontaler Erkrankungen | 88 | ||
| 5.3.6 Parodontale Therapie | 90 | ||
| 5.3.7 Systematik der Parodontaltherapie | 92 | ||
| 6 - Defekte der Hart- und Weichgewebe | 97 | ||
| 6.1 Nicht-kariöse Defekte der Hartgewebe | 97 | ||
| 6.1.1 Einleitung | 97 | ||
| 6.1.2 Klassifikation | 97 | ||
| 6.1.3 Erosionen | 98 | ||
| 6.1.4 Abrasionen und keilförmige Defekte | 101 | ||
| 6.1.5 Empfehlungen an die Patienten | 104 | ||
| 6.2 Defekte der Weichgewebe | 105 | ||
| 6.2.1 Gingivale Rezessionen | 105 | ||
| 6.2.2 Traumatische Veränderungen | 106 | ||
| 6.2.3 Medikamentenbedingte\rVeränderungen | 107 | ||
| 7 - Veränderungen der Mundschleimhaut | 109 | ||
| 7.1 Einleitung | 109 | ||
| 7.2 Anatomische Varianten und Anomalien | 109 | ||
| 7.2.1 Wangenschleimhaut | 110 | ||
| 7.2.2 Zunge | 110 | ||
| 7.3 Veränderungen im Alter | 112 | ||
| 7.4 Mundschleimhauterkrankungen | 112 | ||
| 7.4.1 Krankheitszeichen | 112 | ||
| 7.4.2 Mundkrebs (Karzinom) | 113 | ||
| 7.4.3 Vorkrebs (Präkanzerose) | 113 | ||
| 7.4.4 HIV-Infektion | 115 | ||
| 8 - Ernährung | 117 | ||
| 8.1 Einleitung | 117 | ||
| 8.2 Zucker und andere Kohlenhydrate | 117 | ||
| 8.2.1 Zucker | 117 | ||
| 8.2.2 Polysaccharide | 121 | ||
| 8.3 Zuckeraustauschstoffe und Süßstoffe, erosive Eigenschaften | 121 | ||
| 8.3.1 Zuckeraustauschstoffe | 121 | ||
| 8.3.2 Süßstoffe | 123 | ||
| 8.3.3 Produkte mit erosiven Eigenschaften | 125 | ||
| 8.4 Ernährung und Plaquebildung | 126 | ||
| 8.5 Zahngesunde Ernährung | 130 | ||
| 9 - Fluoride | 135 | ||
| 9.1 Vorkommen | 135 | ||
| 9.2 Fluorid im menschlichen Organismus | 135 | ||
| 9.3 Aufnahme | 136 | ||
| 9.4 Verteilung | 137 | ||
| 9.5 Toxizität von Fluorid | 137 | ||
| 9.5.1 Akute Toxizität | 138 | ||
| 9.5.2 Chronische Toxizität | 139 | ||
| 9.6 Neurotoxizität | 140 | ||
| 9.7 Karzinogenität | 141 | ||
| 9.8 Wirkungsmechanismen von Fluorid | 141 | ||
| 9.8.1 Chemische Wirkung des Fluorids | 141 | ||
| 9.8.2 Bedeutung der Kalziumfluorid-Deckschicht | 142 | ||
| 9.8.3 Antibakterielle Wirkung | 142 | ||
| 9.8.4 Fluorid und Dentin | 143 | ||
| 9.9 Systemische und lokale Fluoridwirkung | 144 | ||
| 9.10 Verschiedene Fluoridverbindungen | 144 | ||
| 9.11 Möglichkeiten der Fluoridprophylaxe | 145 | ||
| 9.11.1 Trinkwasserfluoridierung | 146 | ||
| 9.11.2 Salzfluoridierung | 146 | ||
| 9.11.3 Tablettenfluoridierung | 147 | ||
| 9.11.4 Fluorid-Gelees | 147 | ||
| 9.11.5 Fluorid-Lacke | 147 | ||
| 9.11.6 Fluorid-Spüllösungen | 147 | ||
| 9.11.7 Touchierlösungen | 148 | ||
| 9.11.8 Prophylaxepasten | 148 | ||
| 9.11.9 Zahnpasten | 148 | ||
| 9.12 Empfehlungen zur Fluoridprophylaxe | 148 | ||
| 10 - Antibakterielle Wirkstoffe zur professionellen Anwendung | 151 | ||
| 11 - Risikobestimmung | 153 | ||
| 11.1 Bestimmung des\rParodontitis-Risikos | 153 | ||
| 11.1.1 Mikroorganismen | 153 | ||
| 11.1.2 Abwehrlage des Organismus | 155 | ||
| 11.1.3 Risikoscreening | 156 | ||
| 11.2 Kariesrisikobestimmung | 158 | ||
| 11.2.1 Was bedeutet Kariesrisiko? | 159 | ||
| 11.2.2 Risikofaktor und Risikoindikator | 159 | ||
| 11.2.3 Relatives Risiko und Odds Ratio | 159 | ||
| 11.2.4 Risikoscreening | 160 | ||
| 11.2.5 Risikodiagnostik | 161 | ||
| 11.2.6 Praktische Verfahren zur Bestimmung des Kariesrisikos | 161 | ||
| 11.2.7 Empfehlungen Kariesrisikobestimmung | 163 | ||
| 12 - Psychologie | 165 | ||
| 12.1 Zahnmedizinische Prävention – Psychologische Sichtweise | 165 | ||
| 12.2 Ziele und Aufgaben der Individualprophylaxe | 167 | ||
| 12.3 Kommunikation: Gesprächsgestaltung mit dem Patienten | 168 | ||
| 12.3.1 Methoden zur Bewusstseinsförderung | 168 | ||
| 12.3.2 Ziele der Gesprächsgestaltung | 169 | ||
| 12.3.3 Ansprache des Patienten, erster Eindruck vom Patienten | 169 | ||
| 12.3.4 Aufbau von Vertrauen | 170 | ||
| 12.3.5 Pflegeanamnese | 170 | ||
| 12.3.6 Analyse der vorhandenen Defizite | 172 | ||
| 12.3.7 Abklärung der Mitarbeitsbereitschaft | 173 | ||
| 12.3.8 Patientenauswahl | 174 | ||
| 12.4 Methoden der Motivierung | 174 | ||
| 12.4.1 Motivierbarkeit von Patienten: die Drittel-Regel | 175 | ||
| 12.4.2 Drei Schritte für eine\rsystematische Motivierung | 175 | ||
| 12.4.3 Bedingungen für eine erfolgreiche Motivierung | 176 | ||
| 12.4.4 Unterscheidung der Patienten hinsichtlich ihrer Motivierbarkeit und Mitarbeitsbereitschaft: das Tran\rtheoretische Mode... | 176 | ||
| 12.4.5 Das gesundheitspsychologische Modell von Schwarzer und Mitarbeitern: Health Action Process Model (HAPA) | 179 | ||
| 12.4.6 Motivierende Gesprächsführung | 181 | ||
| 12.5 Präventionskonzept der „oral self care“ im Überblick | 183 | ||
| 12.5.1 Konzept der sechs Schritte | 183 | ||
| 12.5.2 Zielbestimmung und Interventionsplanung | 183 | ||
| 12.5.3 Wissensvermittlung | 183 | ||
| 12.5.4 Fertigkeitstraining | 185 | ||
| 12.5.5 Einsatz geeigneter Verstärker | 186 | ||
| 12.5.6 Festigung des neuen Gewohnheitsmusters | 188 | ||
| 12.5.7 Vorgehen beim Durchführungsdefizit: vertiefte Motivationsanalyse und gemeinsame Suche nach einem Ausweg | 189 | ||
| 12.6 Kompetenzen der Einstellungs- und Verhaltensänderung | 190 | ||
| 12.6.1 Verhaltenstheoretisches Grundmodell | 190 | ||
| 12.6.2 Die Rolle der Kognitionen | 191 | ||
| 12.6.3 Beurteilungsbogen zum eigenen Training | 192 | ||
| 12.6.4 Abschließende Betrachtung | 192 | ||
| 13 - Praxis der Prophylaxe | 195 | ||
| 13.1 Motivierung des Patienten | 195 | ||
| 13.1.1 Grundsätzliches | 195 | ||
| 13.1.2 Techniken bei der ersten Motivierung | 196 | ||
| 13.1.3 Remotivierung | 201 | ||
| 13.2 Mundhygieneinstruktion | 202 | ||
| 13.2.1 Zahnbürsten | 202 | ||
| 13.2.2 Zahnputztechniken | 205 | ||
| 13.2.3 Hilfsmittel für die Zwischenraumpflege | 207 | ||
| 13.2.4 Elektrische Zahnbürsten | 212 | ||
| 13.2.5 Zahnpasten | 218 | ||
| 13.2.6 Spüllösungen | 225 | ||
| 13.3 Ernährungsberatung | 229 | ||
| 13.3.1 Ernährungsanamnese | 229 | ||
| 13.3.2 Analyse der Ernährungsanamnese | 229 | ||
| 13.3.3 Individuelle Beratung des Patienten | 230 | ||
| 13.3.4 Ernährungsberatung in der Gruppenprophylaxe | 231 | ||
| 13.4 Professionelle\rZahnreinigung | 232 | ||
| 13.4.1 Mechanische Scaler | 233 | ||
| 13.4.2 Pulver-Wasser-Strahlgeräte | 235 | ||
| 13.4.3 Parodontale Handinstrumente | 236 | ||
| 13.4.4 Politur der Zahnoberflächen | 241 | ||
| 13.4.5 Interdentalraumreinigung | 244 | ||
| 13.5 Fluoridierung | 246 | ||
| 13.6 Füllungspolitur | 247 | ||
| 13.7 Fissurenversiegelung | 249 | ||
| 13.7.1 Ziele | 249 | ||
| 13.7.2 Grundlagen | 250 | ||
| 13.7.3 Wirksamkeit | 251 | ||
| 13.7.4 Technik | 252 | ||
| 13.8 Prophylaxe bei Implantat-Versorgungen | 253 | ||
| 13.8.1 Implantat und orale Gewebe | 254 | ||
| 13.8.2 Pflege des Implantats | 255 | ||
| 13.9 Der Patient mit besonders hoher Kariesaktivität | 258 | ||
| 13.9.1 Radioxerostomie-Patienten | 258 | ||
| 13.9.2 Patienten mit Wurzelkaries | 259 | ||
| 13.9.3 Schulkinder mit besonders hoher Kariesaktivität | 260 | ||
| 13.9.4 Nuckelflaschenkaries | 261 | ||
| 14 - Halitosis | 263 | ||
| 14.1 Einleitung | 263 | ||
| 14.2 Diagnostik unter\rPraxisbedingungen | 264 | ||
| 14.3 Behandlung von Mundgeruch in der Zahnarztpraxis | 266 | ||
| 14.4 Wie sag ich's dem Patienten? | 268 | ||
| 15 - Integration der Prophylaxe in den Praxisablauf | 269 | ||
| 15.1 Prophylaxe als Aufgabe des Praxisteams | 269 | ||
| 15.2 Voraussetzungen | 271 | ||
| 15.2.1 Instrumente | 271 | ||
| 15.2.2 Personal | 274 | ||
| 15.3 Organisation | 275 | ||
| 15.3.1 Verwaltungstechnische Organisation der Prophylaxe | 275 | ||
| 15.3.2 Organisation der Prophylaxemaßnahmen | 275 | ||
| 15.3.3 Der Prophylaxeshop | 277 | ||
| 16 - Prophylaxe-Qualifikationen im Vergleich | 279 | ||
| 16.1 Internationale Situation | 279 | ||
| 16.2 Arbeitsgebiete und\rQualifikationsstufen | 281 | ||
| 16.3 Die Situation in Deutschland: ZMP, ZMF und DH | 282 | ||
| 16.4 Gesetzliche Grundlage | 286 | ||
| 16.5 Ausblick und Empfehlung | 287 | ||
| 17 - Delegation in der Zahnarztpraxis | 289 | ||
| 17.1 Delegationsmanagement in der Zahnarztpraxis | 289 | ||
| 17.2 Delegation und Behandlungsvertrag | 289 | ||
| 17.3 Vermehrtes Verantwortungsbewusstsein, Vertrauenskultur | 290 | ||
| 17.4 Basis: abhängiges\rBeschäftigungsverhältnis | 292 | ||
| 17.5 Delegationsrahmen Zahnheilkundegesetz | 292 | ||
| 17.6 Interpretation/Leitlinie der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) | 294 | ||
| 17.7 Kompetenz für\rInformation und Aufklärung | 295 | ||
| 17.8 Patienteneinwilligung in Delegation | 297 | ||
| 17.9 Zahnärztliche Begleitung und Überwachung im Kontext mit Qualitätsmanagement | 297 | ||
| 17.10 Haftung | 298 | ||
| 17.11 Perspektiven der\rProfessionalisierung | 299 | ||
| 17.12 Einsatzrahmen Delegation nach Qualifikationsstufen | 300 | ||
| Glossar | 303 | ||
| A | 303 | ||
| B | 303 | ||
| C | 303 | ||
| D | 303 | ||
| E | 304 | ||
| F | 304 | ||
| G | 305 | ||
| H | 305 | ||
| I | 305 | ||
| K | 306 | ||
| L | 306 | ||
| M | 306 | ||
| N | 307 | ||
| O | 307 | ||
| P | 307 | ||
| R | 308 | ||
| S | 308 | ||
| T | 308 | ||
| U | 309 | ||
| V | 309 | ||
| W | 309 | ||
| X | 309 | ||
| Z | 309 | ||
| Literatur | 311 | ||
| Empfohlene Lehrvideos | 318 | ||
| Zur kontinuierlichen Weiterbildungempfohlen | 318 | ||
| Webseiten | 318 | ||
| Register | 319 | ||
| A | 319 | ||
| B | 319 | ||
| C | 319 | ||
| D | 319 | ||
| E | 320 | ||
| F | 320 | ||
| G | 321 | ||
| H | 321 | ||
| I | 321 | ||
| J | 322 | ||
| K | 322 | ||
| L | 322 | ||
| M | 323 | ||
| N | 323 | ||
| O | 323 | ||
| P | 324 | ||
| Q | 325 | ||
| R | 325 | ||
| S | 325 | ||
| T | 326 | ||
| U | 326 | ||
| V | 326 | ||
| W | 326 | ||
| X | 326 | ||
| Z | 326 |
